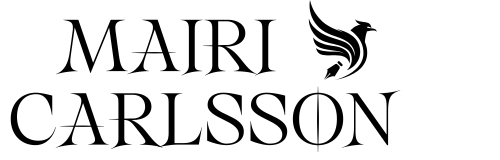Ein zerbrochenes Bündnis.
Ein Gefangener, der auf Rache sinnt.
Und ein stummer Künstler, dessen Werke lebendig werden …
»Ich entscheide, wer lebt und wer stirbt.«
– Solon –

Hinweis zur Leseprobe:
- Die unten folgende Online-Version enthält Kapitel 1 und den Anfang von Kapitel 2.
- In der vollständigen EPUB-Version (zum Download) erwartet dich das komplette 2. Kapitel und zusätzlich der geheimnisvolle Prolog: Eine mystische Begegnung zwischen der Königin der Schatten und der Hohepriesterin eines Hexenzirkels, die den Grundstein für alles Kommende legt.
Du kannst de EPUB-Datei nach dem Download entweder an die E-Mail deines E-Readers schicken oder direkt mit deiner bevorzugten App für E-Books öffnen (Geräte-/App-abhängig). Bei Fragen oder Problemen schreib mir gerne direkt.
Kapitel 1: SOLON
Der Nebel hat mich aufgespürt. Wieder einmal. Wie ein lautloses Raubtier schleicht er über die ungeschützten Ausläufer der Salzsteppe, gierig, hungrig nach seiner Beute. Mir bleiben nur wenige Herzschläge. Mit einem Hechtsprung rette ich mich ins Innere der Höhle, keinen Augenblick zu früh. Eine dichte, weißliche Wolke verschluckt den Eingang, ihre Schwaden tasten nach mir wie gespenstische Finger. Wäre ich vor lauter Müdigkeit nicht über diese verdammte Wurzel gestolpert und rechtzeitig aufgeschreckt, hätte er mich erwischt. Und das wäre es dann gewesen. Für immer und ewig.
Schwer atmend weiche ich vor den Nebelschwaden zurück und lasse mich an der Wand zu Boden gleiten.
Das einzig Lebendige im Nirgendwann ist das Nirgendwann selbst, hat der Schattenmar einmal zu mir gesagt. Ich bin geneigt, ihm zuzustimmen. Dieses Mal ist es verdammt knapp gewesen. Je länger meine Gefangenschaft andauert, desto unachtsamer werde ich. Oder das Nirgendwann wird geschickter darin, meine Fluchtversuche vorauszuahnen.
Der Nebel tötet nicht, o nein, er ist viel hinterhältiger. Er bringt das Vergessen. Sie nennen ihn den Odem des Nirgendwann. Den Atem einer toten Welt. Welche Ironie.
Ich habe keine Ahnung, wie lange ich nutzlos herumsitze, aber da der Odem keine Anstalten macht, sich zu verziehen, beschließe ich, meinen Zufluchtsort näher zu erkunden. Mit etwas Glück vergisst das Nirgendwann meine Anwesenheit, und in zehn Jahren oder hundert kann ich meinen Weg fortsetzen.
Der Nebelschein verbreitet genug Licht, dass ich die Konturen des Gesteins erkennen kann. In der Tiefe der Höhle weckt ein merkwürdiges Glitzern meine Aufmerksamkeit. Vielleicht sind es nur ein paar Quarzsplitter, vielleicht ist es aber auch ein zweiter Ausgang, der mich am Odem vorbeiführen kann.
Geröll knirscht unter meinen Schuhen, während ich mich vorsichtig an der Wand entlangtaste. Sie fühlt sich feucht und klebrig an, aber ich wage nicht, den Kontakt aufzugeben, nur für den Fall, dass sich plötzlich ein Schlammloch unter meinen Füßen auftut oder eine Sandlaus an mir Geschmack findet. Es wäre nicht das erste Mal.
Je tiefer ich vordringe, desto unangenehmer wird die Luft. Ein scharfer, fast beißender Geruch kitzelt mich in der Nase. Er erinnert mich an Williams Atelier. Dicht neben mir huscht ein Schatten vorbei. Jemand stößt einen Fluch aus, gefolgt von einem metallischen Klappern. Ich bleibe stehen. Mit Sinnen, die ich schon seit langer Zeit nicht mehr benutzt habe, lausche ich in das Halbdunkel. Nichts. Es ist totenstill, abgesehen von meinem eigenen unruhigen Herzschlag. Draußen tobt der Odem lautlos wie ein Grab. Er muss meinen Geist mehr verwirrt haben als gedacht. Es passiert mir immer häufiger, dass ich seltsame Visionen erlebe.
Mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend setze ich meinen Weg fort. Bisher war der Höhlengang ebenerdig und so schmal, dass ich mit ausgestreckten Händen die Wände zu meinen Seiten berühren konnte. Doch nach einer scharfen Biegung fällt er plötzlich steil ab. Vor mir öffnet sich ein steinernes Halbrund, das ein antikes Theater hätte sein können. Zerklüftete Felswände mit meterdicken Vorsprüngen erweitern sich ringsum in einem schrägen Winkel nach oben. Der Boden dagegen sieht so glatt poliert aus, als wäre er von Menschenhand gemeißelt worden. Sein Ebenmaß wird nur von einigen Steintrümmern verunziert, die aus der Felsdecke herausgebrochen sein müssen. Sie wirken auf mich wie steinerne Statisten in einem vergessenen Theaterstück.
Ein unruhiges Licht flackert am Ende der Höhle, als ob jemand eine Fackel angezündet hätte, doch nirgends kann ich ein Loch oder gar eine Öffnung erkennen, die auf einen Ausgang hinweist. Ich wage mich einen Schritt nach vorn, als das Geröll plötzlich unter mir nachgibt, als hätte es nur darauf gewartet, dass ich weitergehe. Ich verliere den Kontakt zur Wand und stolpere mit wild rudernden Armen mehrere Meter nach vorn. Mit einem eleganten letzten Hüpfer lande ich auf Händen und Knien inmitten des Steintheaters, als wäre das der finale Akt einer geheimnisvollen Inszenierung.
Toller Auftritt, Solon!
Zum Glück hat mich niemand gesehen. Ich richte mich auf und klopfe mir den Staub von der Hose.
›Ein Gast!‹, krächzt keine Sekunde später eine Stimme in meinem Kopf. ›Welch unerwartetes Vergnügen!‹
So viel dazu.
Langsam drehe ich mich um. Eine Eisharpyie kauert mit ausgebreiteten Flügeln über mir auf einem Felsvorsprung. Sie sieht beinahe hübsch aus mit ihrem blauen Federkleid, in dem Eiskristalle glitzern. Aufgerichtet gleicht sie einer zu groß geratenen Menschenfrau. Sehnen und Muskeln wölben sich dicht unter ihren schillernden Federn. Heller Flaum bedeckt ein puppenhaftes Gesicht; rote Augen glühen darin. Die weiße Federmähne um ihren Kopf lässt sie elegant und trotz ihrer Größe fast zerbrechlich wirken. Wenn da nur ihre Krallen nicht wären.
»Ganz meinerseits.« Ich zupfe meine Hemdsärmel zurecht und taste dabei unauffällig nach dem Granitsplitter in meiner Jackentasche.
Die Eisharpyie antwortet mit einem Laut, der meine Ohren zum Klingeln bringt. Fast hätte ich vergessen, dass die Biester nur telepathisch kommunizieren können. Ihre Lippen, voll und rot wie reife Kirschen, aber unfähig Worte zu formen, verziehen sich und geben den Blick auf spitze Zähne frei. Mit einem tigergleichen Sprung landet sie zwei Meter entfernt von mir im Halbrund. Ich widerstehe dem Impuls, vor ihr zurückzuweichen. Ihre Mähne fließt über ihren Rücken und bildet einen Bausch aus flaumigen, seidenweichen Federn, um den sie ein Pfau beneiden würde.
Sie legt den Kopf schräg. ›Du bist der, den sie den Weltengänger nennen.‹
Die Worte kitzeln mich unangenehm hinter der Stirn. Wie mag ich ihr wohl erscheinen? Äußerlich kaum mehr als ein Mensch, ein Mann mit ungewöhnlichen Augen, in zerschlissenen Kleidern, vor Staub und Schmutz starrend und schwach? Ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr in einen Spiegel geblickt.
›Du hast von mir gehört‹, antworte ich ihr in Gedanken, indem ich meinen Geist gerade weit genug öffne, um meine Worte in Bilder und Emotionen zu hüllen. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal auf diese Weise unterhalten habe. Meine Gedankenstimme ist genauso rau, wie die Stimme meines physischen Körpers nach monatelangem Schweigen wäre.
›Schon unseren Küken erzählen wir Schauergeschichten von dir.‹ Sie mustert mich von oben bis unten. ›Magier ohne Magie. Du bist Opfer deines eigenen Fluchs geworden.‹ Ihre Gedankenstimme, gurrend wie eine Taube hinter meiner Stirn, klingt höhnisch.
Die Eisharpyie zwirbelt mit der Klaue eine Haarsträhne neben ihrem Ohr. Ohrloch. Was mich daran erinnert, dass ich ihr in dieser Höhle wehrlos ausgeliefert bin. Meine letzte Waffe habe ich bei einer unbedachten Wette an den Schattenmar verloren.
Ich bewege mich ein paar Schritte zur Seite, damit ich die Felswand im Rücken habe.
›Die Wahrheit kann sich nicht immer mit der Legende messen‹, antworte ich ihr mit einem Achselzucken. ›Du hast nicht zufällig vorhin einen Schatten gesehen? Oder Stimmen gehört?‹
Erneut stößt sie diesen kreischenden Laut aus, der wohl ein Lachen sein soll. ›Das Nirgendwann hat deine Sinne verwirrt, Weltengänger. Du klingst wie ein Gargoyle. Die hören auch Stimmen, wo keine sind.‹
Eisharpyien mögen nicht die geselligsten Bewohner des Nirgendwann sein, aber sie sind äußerst gut informiert. Nur weil sie stumm sind, bedeutet das nicht, dass sie dumm sind. Tatsächlich lauschen sie aufmerksamer als andere, da sie nicht nur telepathisch kommunizieren, sondern auch die Gedanken von Wesen aufschnappen können, die nicht gelernt haben, ihren Geist nach außen hin abzuschirmen.
›Ist das nicht der Grund, warum du hier bist?‹ Sie macht einen Schritt auf mich zu, ich weiche ein Stück zurück. ›Weltengänger?‹
Das Miststück hat sich in meine Gedanken geschlichen. Habe ich in der Verbannung derart gelitten, dass eine niedere Kreatur wie die Eisharpyie so mühelos in meinen Geist eindringen kann, als wäre er ein offenes Buch? Die kleinste Schwäche, die ich zeige, könnte mein Ende bedeuten. Im Gegensatz zu ihr besitze ich nur meine Hände und einen scharfkantigen Granitsplitter, um mich zu verteidigen. Meine Zírkräfte sind im Nirgendwann wirkungslos. Mit ihrem menschenähnlichen Oberkörper, den muskulösen Beinen, die an einen Strauß erinnern, und den schmalen, federbedeckten Flügeln, die sich zwischen Ellbogen und Hüfte spannen, ist die Eisharpyie nicht nur drei Köpfe größer, sondern auch doppelt so stark wie ich. Wenn sie mich angreift, muss ich mir etwas einfallen lassen. Die Höhle bietet keinerlei Fluchtmöglichkeit, denn draußen lauert der Odem auf mich.
›Wie du so trefflich bemerkt hast, bin ich hier nichts weiter als ein Mann ohne Magie. Ein Gefangener an diesem Ort, genau wie du. Und ich besitze nicht die scharfen Augen und Ohren der stolzen Eiskriegerinnen.‹ Ein wenig Schmeichelei hat noch bei keiner Verhandlung geschadet. In meinem Geist lasse ich sie das Bild ihrer freien Schwestern sehen, die einst in Palästen aus Eis und Diamanten über die eisigen Frostwüsten jenseits der Feenreiche geherrscht haben. ›Ist Freiheit nicht das, was du dir am meisten wünschst? Ich kann dir dazu verhelfen.‹
Sie umkreist mich hungrig, von links nach rechts und wieder zurück. Ich halte die Felswand in meinem Rücken.
›Wir fürchten weder das Nirgendwann noch den Odem, der es umgibt. Und noch weniger fürchten wir dich.‹ Ihre roten Augen leuchten auf, als sie einen weiteren Meter auf mich zuspringt. Ich stolpere zurück, bis ich die Felswand in meinem Rücken spüre. ›Jenseits der Tanzenden Berge wirst du finden, was du so sehnsüchtig suchst.‹
Das Biest spielt mit mir. Ich habe das gesamte Nirgendwann nach einem Fluchtweg durchstreift, jede Holzansammlung, die sich Wald schimpft, jede Wüste, jeden Berg. Jeden verdammten Ort, bis auf einen. Das Nirgendwann ist endlos, ein Labyrinth, in dem man sich verlieren kann. Ganz gleich, welche Richtung man einschlägt, entweder landet man dort, von wo aus man aufgebrochen ist, oder man fällt dem Odem zum Opfer. Er verschlingt alles, sogar die Erinnerung. Die Sehnsucht nach Freiheit ist das Einzige, was mich antreibt. Doch jedes Mal, wenn der Nebel sich anschleicht, bringt sie mich an den Rand des Vergessens. Meine Route hat mich immer näher an die Tanzenden Berge herangeführt, aber mich dort blicken zu lassen, käme einem Todesurteil gleich – und das weiß die Eisharpyie genau. Genauso gut könnte ich mich selbst in den Odem werfen. Etwas, das sie zweifellos mit mir vorhat, wenn ich das Funkeln in ihren Augen richtig deute.
Habe ich eine Wahl? Vielleicht war die Stimme, die ich vorhin gehört habe, keine Narretei des Nirgendwann, sondern ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Eisharpyien sind hinterhältige Kreaturen, aber sie lügen nicht. Niemals.
›Dann ist es wahr? Dort existiert Zeit?‹
Sie lacht wieder. ›Deine Verzweiflung riecht köstlich. Aber die Antwort darauf wirst du selbst finden müssen. Solange du schneller bist als ich.‹
Mit ausgestreckten Klauen springt sie auf mich zu, ihre Mähne wallt wie ein Schleier hinter ihr her. In ihren Augen leuchtet die blanke Mordlust. Ein Kratzer von ihr reicht aus, um mein Blut zu Eis erstarren zu lassen. Wortwörtlich. Ihre Krallen sind eine unschätzbar wertvolle Waffe im Nirgendwann, wo nichts endgültig ist. Nicht einmal der Tod.
Ich springe zur Seite und werfe mich im selben Moment zu Boden. Ihre Größe ist zugleich ihre Schwäche. Ihr muskulöser Körper ist für weite Ebenen aus Eis und Schnee geschaffen. Auf dem steinigen Felsboden bewegt sie sich ungeschickt. Ein Tritt von hinten in ihre Kniekehlen lässt sie wanken, ein zweiter gegen die Knöchel bringt sie zu Fall. Ich packe einen Felsbrocken mit beiden Händen. Sie rollt sich auf den Rücken, doch bevor sie sich aufrichten kann, schmettere ich den Stein auf ihren Schädel. Blut spritzt aus ihren Nüstern in mein Gesicht und besprenkelt ihre weiße Mähne mit roten Flecken. Eine ihrer Krallen hat meinen Hemdsärmel aufgerissen, doch die Haut darunter ist unverletzt. Ich darf nicht zögern. Falls sie geistigen Kontakt zu ihren Schwestern aufgenommen hat, werden sie mich aufspüren.
Die Eisharpyie ist nur halb bei Bewusstsein. Ein heiseres Krächzen entweicht ihrer Kehle. Sie versucht mich zu packen, aber ihre Gliedmaßen sind gelähmt. Ihre Finger, vier an jeder Hand, dünn und sehnig, zucken krampfartig. Die Krallen, die daraus hervorwachsen, sind gebogen wie Sicheln und größer als meine Handfläche.
Ich packe die Eisharpyie an ihrer Mähne und schleife sie über den Boden zur Wand, wo ich ihren Hinterkopf so oft gegen den Felsen schlage, bis sie sich nicht mehr bewegt. Erst dann widme ich mich ihren Klauen. Mit dem Granitsplitter, den ich als Ersatz von Waffe und Werkzeug bei mir trage, schneide ich das oberste Glied ihres Fingers ab. Es ist eine eklige, schweißtreibende Arbeit. Die Haut ist ledrig und zäh, der Knochen darunter hohl, aber fast so hart wie Stein. Kaum bin ich damit fertig, beginnt sich die Wunde bereits wieder zu schließen. Ich wickle die abgetrennte Kralle in ein Stück Hemdstoff, damit sie nicht mit meiner Haut in Berührung kommt, und verzichte darauf, mir weitere Krallen zu nehmen. Selbst wenn die Eisharpyie ihre Schwestern nicht mehr zu Hilfe rufen konnte – sie sind Rudeltiere und geistig miteinander verbunden. Wenn sie den Kontakt zu ihrer Schwester verlieren, werden sie nach ihr suchen. Mir bleibt daher keine Wahl.
Mein Atem geht keuchend, während ich ihren leblosen Körper durch den Höhlengang hinter mir herziehe. Mehr als einmal rutsche ich auf dem Geröll aus. Der Schweiß läuft mir in Strömen über den Körper, als ich schließlich den Eingang erreiche. Draußen geistert noch immer der Odem umher, aber er ist schwächer geworden. Das milchig-trübe Weiß ist zu einem Schleier verblasst, durch den ich die Konturen der kargen Landschaft erkennen kann. Der Odem ist mehr als nur eine undurchdringliche Mauer in einem perfekten Gefängnis. Wer in ihn eingeht, dessen gesamte Existenz wird ausgelöscht – jede Erinnerung an ihn, jede Tat, die er begangen hat. Es ist, als hätte es ihn nie gegeben. Er wird vergessen, und mit ihm verschwindet alles, was er in seinem Leben erreicht hat. Ich kann mir kein schlimmeres Schicksal vorstellen.
Die Höhle liegt auf einer flachen Anhöhe. Der Nebel, der langsam abklingt, wabert sanft auf und ab, weiß und gleißend und beinahe wunderschön. Es fühlt sich an, als stünde ich auf dem schwankenden Deck eines Schiffes. Die Bewegung beruhigt mich. Fast scheint es, als ob sie mich in einen tiefen Schlaf wiegen will, und für einen kurzen Augenblick erwäge ich, mich dieser Ruhe hinzugeben. Alles vergessen, was geschehen ist. Ist dieser Frieden nicht genau das, was ich mir immer gewünscht habe?
Das Stöhnen der Eisharpyie reißt mich aus dem Bann. Mit klopfendem Herzen weiche ich zurück in die Höhle. Noch einen Schritt, und ich wäre nichts weiter als eine verblassende Erinnerung in den Köpfen jener, die ihren Kindern Geschichten über meine Taten erzählt haben. Weniger als nichts. Das ist das eine Schicksal, das ich nicht akzeptieren kann.
Ich zerre die Eisharpyie vor den Eingang, wobei ich darauf achte, ihren Körper zwischen mir und dem Nebel zu halten, der mit dünnen Fingern nach mir greift. Ich spüre seine Kälte bis in die Knochen, doch diesmal liegt keine Ruhe oder Frieden in seiner Berührung, sondern nur eisige Gier.
Die Augen der Eisharpyie sind zu schmalen Schlitzen geöffnet. Sie erwacht. Vielleicht spürt sie den Odem in ihrem Gesicht und ahnt, was ich vorhabe. Einen Moment lang koste ich ihre Angst aus. Auch sie fürchtet sich davor, vergessen zu werden. Welche Kreatur würde das nicht?
›Ich habe dir die Wahl gelassen‹, sage ich in Gedanken zu ihr und schicke ihr das Bild ihrer alten Heimat, wie ich sie zuletzt gesehen habe: verwüstet von den Fomorenkriegen, die Paläste aus Eis im Feuer geschmolzen wie flüssiges Blei und die weiten Ebenen aus Schnee, Kälte und Diamanten verwandelt in einen leeren, grauen Ozean, in dem das Blut ihrer getöteten Schwestern fließt. ›Du hättest mich mehr fürchten sollen als dein Gefängnis.‹
Ich versetze ihrem Körper einen Stoß. Ein zischender Laut entweicht ihren Lippen, als sie von der Anhöhe stürzt. Ein Hügel nur, und doch scheint der Fall endlos zu sein. Wolkenwellen schlagen über ihr zusammen. Der Odem verschluckt ihren Körper in einem blendenden Weiß, still und endgültig wie ein Grab. Eine einsame blaue Feder schwebt durch die Luft und landet zu meinen Füßen. Ich hebe sie auf. Sie und die Kralle – das ist alles, was von der Eisharpyie bleibt.
Ich weiß nicht, ob es Gnade oder Grausamkeit ist, aber so wird sie nicht ganz vergessen sein.
›Wenn es dir ein Trost ist …‹, sage ich in Gedanken zu ihr, während ich mich vom Odem abwende, bevor er erneut nach meinem Geist greifen kann, ›… ich werde einen Ausweg finden. Und dann werde ich die Erinnerung an dich mit mir in die Freiheit tragen.‹
Kapitel 2: ADAM
Die Kralle des Gargoyles bereitete ihm Schwierigkeiten. Ihre Proportionen waren zu zart im Vergleich zum mächtigen Körper des Monsters. Mit ausgebreiteten Flügeln stand es bereit, sich von den Ruinen des Turms in die Lüfte zu erheben. Sein goldfarbenes Auge leuchtete vor dem Dunkel des verfallenen Bauwerks, eine Warnung an unachtsame Wanderer, sich ihm nicht zu nähern, denn das Monster war hungrig. Seine Brüder kreisten hoch über ihm auf der Jagd nach Beute, jedoch waren sie kaum mehr als Schatten vor dunklen Wolkenmassen.
Adam korrigierte die Ausrichtung des Projektors um winzige Millimeter, aber das Ungleichgewicht blieb bestehen. Der Einfallswinkel des Lichts entsprach genau seinen Berechnungen und der Abstand der halbtransparenten Spiegelflächen zwischen den Projektoren stimmte ebenfalls. Er musste wohl oder übel seine Computergrafik überprüfen und gegebenenfalls die Kralle neu skalieren.
Auf dem Bildschirm sah das Arrangement perfekt aus, doch sobald er das dreidimensionale Hologramm aktivierte, wurden die kleinsten Makel sichtbar. Davon abgesehen war die Holografie bei weitem sein bestes Werk. Die technologische Ausrüstung, die Stella Fortune ihm zur Verfügung gestellt hatte, übertraf sogar die Ausstattung seiner Universität, ganz zu schweigen von den Programmen, die er sich für sein privates Computernetzwerk leisten konnte. Zudem wurde er für diesen Job gut bezahlt. Grund genug für ihn, sich in einem prunkvollen Kirchenschiff in gut vier Metern Höhe auf ein wackliges Gerüst zu schwingen, als wäre er Michelangelo unter der Kuppel der Sixtinischen Kapelle.
Zu dumm, dass er nicht schwindelfrei war.
…
Ende der Leseprobe
Möchtest du weiterlesen? Kein Problem!
„Der Pakt von Babylon: Verbannt“ erscheint am 5.5.2025
Hat dir die Leseprobe gefallen?
Dann freue mich mich, wenn du „Der Pakt von Babylon: Verbannt“ auf deine Wunschliste setzt.
Und wenn du noch mehr von mir lesen willst, dann schau dich in meinem Buchuniversum um. Es ist bestimmt etwas für dich dabei. Denn wer weiß, welche neuen Geschichten im Zwielicht noch auf dich warten …

Mairi