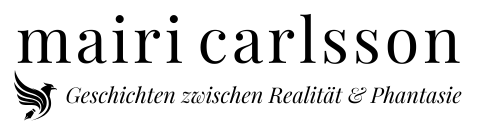Meine lieben Leserinnen und Leser,
gestern kam eine ungewöhnliche Besucherin in meine Apotheke. Das Glöckchen klingelte gegen sieben Uhr abends, so leise, dass ich zuerst dachte, der Wind hätte es bewegt. Aber als ich von meiner Kasse aufblickte, stand sie da: eine Frau in Grau, die aussah, als würde sie jeden Moment in den Schatten verschwinden. Ein paar vereinzelte Regentropfen glitzerten an ihr, der einzige Farbtupfer an ihrer blassen Erscheinung.
»Entschuldigung«, sagte sie, und ihre Stimme klang dünn wie Seidenpapier. »Haben Sie einen Moment Zeit?«
Eigentlich nicht. In fünf Minuten hätte ich den Laden geschlossen. Feierabend. Außerdem musste ich das Treffen mit der Banshee um Mitternacht vorbereiten. Aber während ich die Dame betrachtete, überkam mich das untrügliche Gefühl, dass sie keine der üblichen Kundinnen war, die kurz vor Feierabend noch ein Aphrodisiakum für ihr Tinder-Date besorgen wollten. Aufdringliche Kunden abwehren ist das eine, Hilfe leisten, wo sie benötigt wird, das andere.
»Für Sie immer.« Ich deutete auf den Hocker am Tresen. »Tee? Ich habe eine ausgezeichnete Mischung aus Melisse und Rosenblüten.«
Sie nickte und ließ sich auf den Hocker sinken. Beinahe schien sie mit ihm zu verschmelzen. Ich blickte mich nach meiner Sphygo um – gewöhnliche Menschen sehen in ihr lediglich eine schwarze Katze – aber das Biest hatte sich eine getrocknete Sardine geschnappt und sich in eine dunkle Ecke verkrochen. Auf ihren Beistand brauchte ich nicht zählen. Dabei wirkte die Frau, als hätte sie gerade jetzt ein warmes Fellknäuel zum Festhalten gebrauchen können.
»Erzählen Sie«, sagte ich, während ich die Teeblätter in den Filter streute und mit kochendem Wasser aufgoß. Teewasser habe ich immer parat (man weiß nie, wann ein Notfall vorbeischaut). »Was führt Sie zu mir?«
»Niemand sieht mich mehr.« Sie rang die Hände und sah mir kurz in die Augen, bevor sie den Blick rasch wieder senkte, fast als schämte sie sich über ihren Wagemut. Ihr Alter war schwer zu schätzen. Sie konnte alles zwischen fünfunddreißig und fünfzig sein. Blaß, aber gepflegt. Ein wenig verhärmt, aber mit einem Grübchen in der Wange. Früher musste sie viel gelächelt haben.
Dann sprudelten die Worte aus ihr heraus. „Im Büro wurde ich bei der Beförderung schon wieder übergangen. Dabei hatte ich monatelang Überstunden gemacht, das Projekt beinahe im Alleingang durchgezogen. Mein Chef hat mich angeschaut. Ich schwöre, er hat mich angeschaut, aber gleichzeitig durch mich hindurchgesehen. Und dann sagte er: ›Schade, dass niemand die Initiative ergriffen hat.‹ Als wäre ich nicht anwesend.«
Ich setzte mich zu ihr und stellte die Tasse vor sie hin. Der Dampf waberte sanft nach oben.
»Letzten Samstag haben meine Freundinnen und ich uns zum Kaffee getroffen. Aber für sie war ich wie Luft. Früher hatten wir angeregte Gespräche …« Sie schluckte. »Doch inzwischen komme ich mir vor wie ein ungewolltes Anhängsel. Akzeptiert, aber nicht integriert. Als hätten wir keinerlei Gemeinsamkeiten mehr.«
Zögerlich griff sie nach der Tasse. Aber sie trank nicht, sondern legte nur die Hände darum, als wäre sie ein Rettungsanker. Möglicherweise ahnte sie die Ursache ihres Problems, wollte es nur nicht wahrhaben. Ich konnte es ihr nicht verdenken. Hier war Fingerspitzengefühl gefragt (nicht meine Stärke, das gebe ich zu).
»Und die Familie?«, fragte ich sanft.
Ihre Stimme zitterte. „Mein Mann geht durch die Wohnung, macht sich Essen, schaut fern. Aber wir sprechen nicht mehr miteinander. Er sieht durch mich hindurch. Und wenn ich ihn darauf anspreche, seufzt er nur, als hätte ich etwas Dummes gesagt. Oder als hätten wir das schon hundertmal diskutiert. Ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache. So war es nie zwischen uns. Gelegentlich stritten wir uns, aber wir führen eine harmonische Ehe. Mal langweilig, mal aufregend, aber nie so …« Sie stockte. »Gleichgültig.«
»Sie machen gar nichts falsch«, versicherte ich ihr. »Ich denke, das wissen Sie.«
Sie nickte, ohne mich anzusehen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Manchmal glaube ich, das geht schon mein ganzes Leben so. Ich war schon immer eine Außenseiterin. Immer dabei, aber nie im Mittelpunkt. Das war okay für mich. Aber inzwischen … Ich habe mich noch nie so … so wertlos und unbeachtet gefühlt wie in den letzten Monaten. Als wäre ich für andere einfach nicht mehr da!«
Endlich blickte sie auf und sah mich direkt an. Ihre Augen waren dunkelveilchenblau. Und doch konnte ich beinahe durch sie hindurchsehen.
Ich seufzte und hakte nach: »Fühlen Sie sich anders? Oder bemerken sie nur, dass ihr Umfeld sie anders behandelt als früher?«
Sie bewegte unbehaglich die Schultern. »Ich weiß nicht. Oder doch … alles fing an, als ich im Frühjahr die Kellertreppe hinunterfiel. Ich verstauchte mir den Knöchel und konnte einige Tage nicht zur Arbeit. Ach, und eine Gehirnerschütterung hatte ich obendrein auch noch. Mein Chef war wütend, weil er deswegen wichtige Termine verschieben musste. Meine Freundinnen zogen ohne mich los. Und mein Mann …« Sie starrte zur Seite, als versuchte sie, sich an etwas Wichtiges zu erinnern. »Mein Mann war völlig aufgewühlt, denn er gab sich die Schuld an dem Unfall. Er hatte die Werkzeugkiste, über die ich gestolpert bin, nicht zur Seite geräumt.«
»Haben Sie sich vollständig von ihrem Unfall erholt?« Ich stand auf und begann, zwischen meinen Regalen umherzuwandern. Nun kam der schwierige Teil.
»Natürlich. Ich meine, ich denke schon.« Sie warf mir einen Blick zu. »Warum fragen Sie?«
„Ich glaube, das ahnen Sie bereits.« Ich nahm Beifuß vom Regal, dann Eisenkraut. Für alle Fälle. Dann deutete ich auf den Spiegel, der neben dem Gewürzregal hing. »Schauen Sie einmal da hinein. Was sehen Sie?«
Sie zog eine Augenbraue nach oben, aber folgte meiner Aufforderung und blickte mit gerunzelter Stirn in den Spiegel. Dann wurde sie noch blasser, als sie ohnehin schon war. »Oh mein Gott«, flüsterte sie. »Ich sehe … nichts.« Sie hob die Hand und bewegte sie hin und her. »Ich habe kein Spiegelbild«, ergänzte sie heiser.
Und der Groschen fällt!
Ich umrundete den Tresen und setzte mich wieder zu ihr. Das Säckchen mit Kräutern steckte in meiner Tasche. Die Dame ahnte die Wahrheit, aber ich wusste nicht, wie sie reagieren würde, wenn die Erkenntnis sie mit voller Wucht traf.
Sie starrte erneut in den Spiegel, dann auf mich, dann wieder in den Spiegel. Mein Spiegelbild lächelte ihr aufmunternd zu.
Ihre Augen wurden riesig. »Bin ich ein Vampir?«
Da musste ich lachen. »Beinah, meine Liebe, beinah. Nun schauen Sie sich bitte selbst einmal an.«
Sie sah an sich herunter, zögerte, hob eine Hand vor die Augen und bewegte die Finger. »Ich bin beinahe durchsichtig«, staunte sie.
»Nein, Sie sind komplett unsichtbar. Aber keine Sorge. Das ist ganz normal, wenn man tot ist.«
Sie öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Ich hielt den Atem an. Dann fing sie an zu lachen.
Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet.
»Das erklärt einiges.« Sie schüttelte sich kurz, holte tief Luft. »Sie haben recht – ich ahnte es bereits. Aber …« Sie hob die Schultern. Wieder perlte ein Lachen aus ihr heraus, hell und befreit. Ihre schmale Gestalt glühte auf einmal, als wäre sie wieder mit Leben erfüllt. Ihr Haar und ihre Augen gewannen an Glanz.
Ich lächelte. Innerlich fiel mir ein Stein vom Herzen. Die meisten Geister wurden wütend, wenn sie die Wahrheit erkannten. Manche griffen einen an (dafür hatte ich vorsorglich die Abwehrkräuter eingesteckt). Andere leugneten ihren Tod schlicht weiterhin. Wieder andere hatten einen Nervenzusammenbruch (das waren die echt harten Fälle, da halfen auch keine Kräuter).
Die Frau schüttelte den Kopf, noch immer amüsiert über ihren Tod. Oder zumindest über die Erkenntnis darüber. Die Geisterwelt war manchmal schon ein wenig verrückt.
»Mein Kollege hat die Beförderung bekommen, dieser unfähige Schleimer. Hätte ich gewusst, dass ich tot bin – ich hätte ihm den Kaffee über sein teures Hemd geschüttet! Ach was, das hätte ich sogar im Leben gemacht.« Sie gluckste.
»Das ist die richtige Einstellung!«
»Und meine Freundinnen! Drei Jahre lang habe ich mir ihre Beziehungsprobleme angehört! Ganz ehrlich, darauf hätte ich schon viel früher verzichten können.« Ihr Lachen wurde leiser. »Mein Mann … Wir hatten uns schon lange auseinandergelebt. Aber er trauert, oder?«
»Ja. Trauer heilt.«
Sie nickte und wischte sich über die Augen. »Was jetzt?«
»Sie haben die Ursache ihres Problems erkannt. Meistens ist das bereits die Lösung. Wenn Sie ein Licht sehen, folgen Sie ihm.« Ich lächelte. »Drüben werden Sie definitiv gesehen.«
»Werde ich dort erwartet? Meine Großmutter ist schon da …«
»Ganz bestimmt. Großmütter warten immer.«
Sie stand auf und lächelte wieder. Ihr Blick war unbeschwert. »Im Leben war ich immer unsichtbarer, als ich es verdient hatte. Selbst dann, wenn ich gesehen wurde. Ich glaube, das wird sich ändern. Spätestens im nächsten Leben.«
Ich drückte ihr die Daumen. Sie verdiente eine neue Chance. Wäre sie nicht rechtzeitig zu mir gekommen, hätte sie womöglich ein Reaper geholt. Dann hätte ihr niemand mehr helfen können.
Sie ging zur Tür – und durch sie hindurch. Das Glöckchen läutete nicht. Draußen begann etwas golden zu leuchten.
Meine Sphygo kam aus der Ecke hervor und schleckte sich übers Maul.
»Ja, du Feigling«, sagte ich zu ihr. »Manchmal hat dieser Job schöne Momente. Auch ohne deine Hilfe.«
Die Tasse Tee stand noch auf dem Tresen, unberührt. Ich trank sie selbst. Mit Honig. Man muss sich auch mal was gönnen.
Verfasst von
Madame Mercer
Freifliegende Hexe, Grimoire-Sammlerin, Apothekerin und Expertin für praktische Magie. Ich lebe seit ich denken kann zwischen den Welten und teile gelegentlich mein Wissen mit jenen, die bereit sind zuzuhören. Warnung: Meine Ratschläge funktionieren – aber nicht immer so, wie erwartet. Das Buch, in dem Sie mich finden: Der Pakt von Babylon